MLZ ist eine Kooperation aus:
 > Technische Universität München
> Technische Universität München > Helmholtz-Zentrum Hereon
> Helmholtz-Zentrum Hereon
 > Forschungszentrum Jülich
> Forschungszentrum Jülich
MLZ ist Mitglied in:
 > LENS
> LENS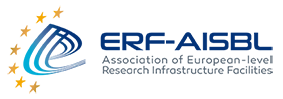 > ERF-AISBL
> ERF-AISBL
MLZ in den sozialen Medien:

MLZ
Lichtenbergstr.1
85748 Garching
05.08.2025
MLZ-Konferenz 2025: Neutronen für die Zukunft von Fusions- und Kerntechnik
62 internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Industrievertreter trafen sich vom 28. bis 31. Juli 2025 zur MLZ-Konferenz „Neutrons for Fusion and Nuclear Applications“ im Schloss Fürstenried in München. Vier Tage lang standen intensive Diskussionen, wissenschaftliche Vorträge und die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Fusionsenergie und Kerntechnik im Mittelpunkt: Neben der zentralen Rolle von Neutronen und Positronen bei der Entwicklung fortschrittlicher, den extremen Bedingungen in Fusionsreaktoren standhaltender Werkstoffe, wurde insbesondere die Dringlichkeit einer Tritium-Versorgungskette betont.
Am Montagmittag füllte sich der „Weiße Saal“ in Schloss Fürstenried mit 62 Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern sowie mit Ingenieurinnen und Ingenieuren, um sich den komplexen Herausforderungen der Fusionsreaktorentwicklung aus dem Blickwinkel der Neutronenwissenschaft zu widmen. Die einleitenden Worte von Prof. Dr. Christian Pfleiderer, Wissenschaftlicher Direktor am FRM II und MLZ, machten deutlich: Es ging nicht nur darum, Ergebnisse zu präsentieren, sondern gemeinsam Wege für die Zukunft zu gestalten.
Nach dem Mittagessen – der ersten Gelegenheit zum Vernetzen und Austausch – begann die erste Vortragsrunde.
Einblicke in die Keynote-Vorträge
Die Konferenz bot fünf Hauptvorträge von führenden Experten:
• Prof. Dr. Rudolf Neu (Forschungsgruppenleiter, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik) eröffnete die Tagung mit folgendem Vortrag: „Aktueller Stand und Herausforderungen bei der Entwicklung plasmaexponierter Komponenten“. Er betonte, dass robuste First-Wall- und Divertor-Materialien für jedes Fusionskraftwerkskonzept unverzichtbar sind.
• Dr. Gianfranco Federici (Programmleiter, EUROfusion) regte mit seinem Vortrag „Testanforderungen für die Entwicklung und Qualifizierung von Fusions-Brutblankets“ eine der lebhaftesten Diskussionen der Konferenz an.
• Prof. Dr. Christian Linsmeier (Direktor am Institut für Plasmaphysik, Forschungszentrum Jülich) sprach über „Folgen der Neutronenbestrahlung plasmaexponierter Werkstoffe und Bauteile“. Er erläuterte die Herausforderungen durch Strahlenschäden, mikrostrukturelle Veränderungen und den Einfluss von Neutronen auf die Lebensdauer wichtiger Komponenten.
• Prof. Dr. Michael Smith (Lehrstuhl für Schweißtechnik, Universität Manchester) brachte mit seinem Vortrag „Wesentliches Werkzeug oder plausibler Unsinn?“ eine philosophische Komponente ein und beleuchtete die Schwierigkeiten bei der Validierung mehrskaliger Simulationen zur Vorhersage des mechanischen Verhaltens von Reaktorkomponenten.
• Dr. Tom Wallace-Smith (Mitgründer und Technischer Direktor, Astral Systems) schloss die Keynotes mit einem industrieorientierten Ausblick auf die „Entwicklung einer skalierbaren Plattform für Fusionsneutronenbestrahlung und Anwendungen der nächsten Generation in der Kerntechnik“ ab.
Von schnellen Neutronen bis zur Plasmaproduktion
Im Verlauf der Woche deckten die 29 Fachvorträge und die Postersession ein breites Themenspektrum ab – von simulationsgestütztem Design fusionsgeeigneter Werkstoffe bis zu experimentellen Untersuchungen zur Neutronen-induzierten Transmutation. Mehrere Sessions stellten zudem neuartige Verfahren zur Plasmaproduktion und -stabilisierung vor, darunter die Positronendiagnostik für grundlegende Einblicke in Plasmaeigenschaften.
Ein roter Faden zog sich durch alle Beiträge: Wie lassen sich Materialgrenzen, Reaktorsicherheit, Tritium-Versorgung und Energieeffizienz gleichzeitig ausdehnen, ohne unrealistische Zeitpläne für die Industrialisierung der Fusion zu verfolgen? Dabei spielte auch die Synergie zwischen den Forschungsschwerpunkten am FRM II und der Fusionsforschung eine wichtige Rolle.

Blick in den Konferenzsaal: In 29 Fachvorträgen diskutierten die Teilnehmenden realistische Wege zur Industrialisierung der Fusion – mit Fokus auf Materialgrenzen, Tritiumversorgung und Synergien zwischen Fusion und Neutronenforschung. © Victoria Bingham, TUM/FRM II
Exkursionen und Zwischengespräche
Ein besonderes Highlight war die Führung durch den FRM II, bei der viele Teilnehmende die leistungsstarke analytische Infrastruktur für Materialuntersuchungen mit Neutronen erleben konnten.
Abseits des offiziellen Programms bot die Konferenz reichlich Raum für spontane Gespräche bei gemeinsamen Mittagessen, im Garten während der Kaffeepausen oder bei der abendlichen Postersession. Im Mittelpunkt standen dabei immer wieder Fragen wie: „Welche Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Industrie sind jetzt notwendig?“, „Wie machen wir die Fusion nicht nur möglich, sondern auch einsatzfähig?“ und „Wie können Kernspaltungs- und Kernfusionsfachleute enger zusammenarbeiten und voneinander lernen?“.
Die Reise in eine nachhaltige Energiezukunft nimmt spürbar Fahrt auf – angetrieben von der Neutronenforschung. Eines ist nach dieser Konferenz sicher: Die Neutronen-Community gestaltet diesen Weg aktiv mit.
Weitere Informationen:
Programm der MLZ Konferenz 2025
Weitere News
-
17.11.2021
MLZ-Conference "Neutrons for Mobility"
MLZ ist eine Kooperation aus:
 > Technische Universität München
> Technische Universität München > Helmholtz-Zentrum Hereon
> Helmholtz-Zentrum Hereon
 > Forschungszentrum Jülich
> Forschungszentrum Jülich
MLZ ist Mitglied in:
 > LENS
> LENS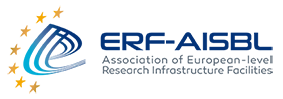 > ERF-AISBL
> ERF-AISBL
MLZ in den sozialen Medien:






