MLZ ist eine Kooperation aus:
 > Technische Universität München
> Technische Universität München > Helmholtz-Zentrum Hereon
> Helmholtz-Zentrum Hereon
 > Forschungszentrum Jülich
> Forschungszentrum Jülich
MLZ ist Mitglied in:
 > LENS
> LENS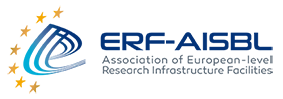 > ERF-AISBL
> ERF-AISBL
MLZ in den sozialen Medien:

MLZ
Lichtenbergstr.1
85748 Garching
13.05.2025
Stärkere Stahlverbindungen dank Neutronen
Mit Hilfe der Neutronenradiographie am Instrument ANTARES des MLZ haben internationale Forscherinnen und Forscher eine Methode zum Nachweis von Bor in Stahl entwickelt. Die Ergebnisse helfen dabei Stahlkomponenten wie in Öl- und Gaspipelines oder der Automobilindustrie und der chemischen Verarbeitung zu verbessern.

Erhitzen einer Stahlprobe für die Bor-Diffusion: Solche Proben wurden später mittels Neutronenradiographie am ANTARES-Instrument des MLZ untersucht. © Nicolás Di Luozzo
Verbinden von Stahlteilen
Stahl ist das Rückgrat von Infrastruktur und Technologie, von Wolkenkratzern bis hin zu Motoren. Das Verbinden von Stahlteilen war jedoch schon immer eine Herausforderung. Herkömmliche Schweißverfahren – wie z. B. Hartlöten – hinterlassen oft uneinheitliche Materialeigenschaften an den Verbindungsstellen, was die Festigkeit und Leistung des Endprodukts beeinträchtigen kann. Dies ist besonders problematisch bei kritischen Anwendungen, bei denen es auf jedes Quäntchen Festigkeit ankommt.
Füllmaterial aus Eisen und Bor
Um das Verbinden von Stahlteilen zu verbessern, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Laboratorio de Sólidos Amorfos, INTECIN, Facultad de Ingeniería (UBA-CONICET), des Heinz Maier-Leibnitz Zentrums (MLZ) und weiterer Einrichtungen eine Methode angewandt, die als „transient liquid phase bonding“ (TLPB) bezeichnet wird. Bei diesem Verfahren wird ein spezielles Füllmaterial – in diesem Fall dünne Metallfolien aus Eisen und Bor (Fe-B) – verwendet, um Stahlteile bei hohen Temperaturen zu verbinden. Sobald die Materialien abkühlen, ist die Verbindung hergestellt. Damit dieser Prozess effektiv funktionieren kann, mussten die Forscherinnen und Forscher jedoch untersuchen, wie sich das Bor in der Verbindung verteilt.
In Stahlverbindungen hineinschauen
Hier spielte ANTARES, eine Neutronenbildgebungsanlage am MLZ, eine entscheidende Rolle. Im Gegensatz zu Röntgenstrahlen, die für oberflächliche Untersuchungen geeignet sind, eignet sich die Neutronenradiographie hervorragend für volumetrische Untersuchungen. Dr. Michael Schulz, stellvertretender wissenschaftlicher Direktor am FRM II, leitender Instrumentenwissenschaftler bei ANTARES und Co-Autor der Studie, erklärt: „Wenn wir einen fokussierten Neutronenstrahl durch die Stahlproben schicken, haben wir die einzigartige Möglichkeit, die Borkonzentration innerhalb der Stahlverbindung mit hoher Genauigkeit und räumlicher Auflösung zu messen, ohne sie zu zerstören.“

In der Öl- und Gasindustrie kommen innerhalb von Bohrlöchern noch häufig Gewinderohre zum Einsatz. © Алексей Закиров / stock.adobe.com
Feste und dehnbare Verbindung
Die Neutronenbilder zeigten eine gleichmäßige Verteilung des Bors über die Verbindung hinweg, mit nur einer kleinen, lokalisierten Konzentration in der Mitte. Dieses Gleichgewicht ist entscheidend – es sorgt dafür, dass die Verbindung stabil bleibt und vermeidet das Bilden spröder Verbindungen, so genannter Boride, die die Verbindung schwächen könnten. Mit diesen Erkenntnissen bestätigten die Forschenden, dass sie mit ihrem Verfahren eine Verbindung herstellen können, die genauso fest und dehnbar ist wie der ursprüngliche Stahl.
Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie
Dieser Fortschritt in der Diffusionsklebetechnik eröffnet zahlreiche Anwendungen, bei denen starke Stahlverbindungen unerlässlich sind. So setzt die Öl- und Gasindustrie beispielsweise innerhalb des Bohrlochs immer noch auf Gewinderohre. Bündige Stahlverbindungen können hingegen extremen Belastungen standhalten, ohne undicht zu werden, und übertreffen dabei bündig ausgeführte Gewindeverbindungen.
Auch in der Automobilbranche könnte das Diffusionskleben neue Konstruktionen ermöglichen, bei denen leichte und haltbare Teile die Kraftstoffeffizienz und Fahrzeugleistung verbessern.
Kostensenkung ohne Qualitätseinbußen
Dr. Nicolás Di Luozzo, Erstautor der Studie von der Universität Buenos Aires, weist auf eine weitere interessante Anwendung bei modernen Wärmetauschern hin: „Wärmetauscher mit gedruckten Schaltkreisen können mit TLPB anstelle des Festkörperdiffusionsbondings hergestellt werden, was zu erheblichen Kostensenkungen ohne Qualitätseinbußen führt.“ Diese Wärmetauscher werden für die Wärmeübertragung in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Erdgasverarbeitung, der Wasserstoffproduktion und in chemischen Verarbeitungsanlagen. Sie müssen extremen Temperaturen und Drücken standhalten, weshalb starke und zuverlässige Verbindungen für ihre Leistung entscheidend sind.
Weil die Stahlverbindungen genauso stark sind wie der Rest des Materials, hat diese Technologie das Potenzial, zu sichereren, effizienteren und langlebigeren Strukturen und Maschinen zu führen.
Originalpublikation:
Nicolás Di Luozzo, Michael Schulz, Michel Boudard, Silvina Limandri, Gastón Garbarino, Marcelo Fontana,
Diffusion bonding of steels with a homogeneous microstructure throughout the joint
Metals & corrosion, 59, 20400 (2024)
DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-024-10343-x
Partner des Projekts:
Laboratorio de Sólidos Amorfos, INTECIN, Facultad de Ingeniería (UBA-CONICET), das Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ), Université Grenoble Alpes, das Instituto de Física Enrique Gaviola, UNC-CONICET und das European Synchrotron Radiation Facility.
MLZ ist eine Kooperation aus:
 > Technische Universität München
> Technische Universität München > Helmholtz-Zentrum Hereon
> Helmholtz-Zentrum Hereon
 > Forschungszentrum Jülich
> Forschungszentrum Jülich
MLZ ist Mitglied in:
 > LENS
> LENS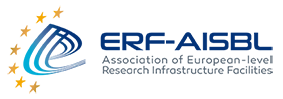 > ERF-AISBL
> ERF-AISBL
MLZ in den sozialen Medien:


