MLZ ist eine Kooperation aus:
 > Technische Universität München
> Technische Universität München > Helmholtz-Zentrum Hereon
> Helmholtz-Zentrum Hereon
 > Forschungszentrum Jülich
> Forschungszentrum Jülich
MLZ ist Mitglied in:
 > LENS
> LENS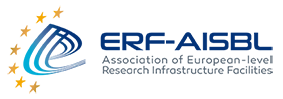 > ERF-AISBL
> ERF-AISBL
MLZ in den sozialen Medien:

MLZ
Lichtenbergstr.1
85748 Garching
26.05.2025
Zugkraft und Präzision: Ein Praktikum am MLZ

Mehrfache Reflexion eines Gegenstands durch einen offenen Neutronenleiter. © Elena Huber, FRM II/ TUM
Forschung an der Neutronen-Tomographieanlage ANTARES, Präzisionsarbeit in der Umformtechnik oder der Bau von Neutronenleitern – die Vielfalt am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) ist riesig. Das durften auch zwei Schüler während ihres Praktikums am MLZ hautnah erleben. Neben ihrem eigenen Projekt zur Entwicklung energieeffizienterer Elektromotoren erhielten sie spannende Einblicke in zahlreiche Bereiche des MLZ und seiner Partner.
Elektromotoren spielen eine immer größere Rolle. Aber wie macht man sie noch leistungsfähiger und effizienter? Das durften die 9.-Klässler Marvin Klyscz von der Realschule an der Blutenburg München und Sebastian Riedel vom Max-Planck-Gymnasium München im Rahmen eines einwöchigen Berufsorientierungspraktikums am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) in Garching herausfinden.
Prägung als Schlüssel zu neuen leistungsdichteren Elektromotoren
„Wir haben eine Referenzprobe, nämlich Elektroblech (eine Art Stahl) ohne Prägung, gegenüber Elektroblech mit Prägung an der Zugprüfmaschine getestet, als Diagramm dargestellt und verglichen“, erklärt der 14-jährige Marvin. Ein sinusförmiges Magnetfeld wird am Elektroblech angelegt und die magnetischen Eigenschaften werden über eine Spule zurückgemessen. Das Elektroblech mit Prägung zeigt dabei schlechtere magnetische Eigenschaften, da die Prägung als Barriere für den magnetischen Fluss agiert. Die dadurch ausgelöste Flusslenkung wird für die Entwicklung neuartiger Elektromotoren mit höherer Drehzahl und Leistungsdichte benötigt. Während im Praktikum nur globale Effekte gemessen werden können, kann die Neutronenbildgebung die Flusslenkung ortsaufgelöst sichtbar machen und analysieren.
Der Moment der Spannung
Bei zunehmender Zugkraft kann der Stahl reißen. „Jetzt setzt bitte eure Schutzbrillen auf und nicht erschrecken, der Knall, wenn der Stahl reißt, kann recht laut werden!“, so bereitet ihr Betreuer Dr. Tobias Neuwirth die Schüler auf den erwarteten Riss der Probe vor. Die Zugprüfmaschine zieht in kleinen, dann immer größeren Schritten – doch nichts passiert: kein Knall, kein Reißen. „Oh, da hatte ich wohl was falsch im Kopf“, gesteht Tobias schmunzelnd. Das Elektroblech würde aufgrund seiner Länge und Eigenschaften erst nach mehr als 100 mm reißen, was aufgrund des Fahrwegs der Zugprüfmaschine nicht möglich war. Am Ende zeigt sich, dass die Elektrobleche mehrere Millimeter gedehnt wurden – ein eindrucksvoller Beweis für die enorme Stabilität der Elektrobleche. Im Elektromotor selbst darf eine solche Dehnung nicht vorkommen, da er sich sonst selbst zerstört.
Diese Blöße lässt Tobias nicht auf sich sitzen, am nächsten Tag werden dann noch gelochte Elektrobleche erfolgreich zerrissen. Die Lochung entspricht dabei dem Industriestandard, um die Flusslenkung in Elektromotoren zu erzeugen.

Sebastian ritzt das Borosilikatglas mit einem Glasschneider an. So wird der Unterschied zum Fensterglas deutlich. © Elena Huber, FRM II/ TUM
Die Proben dürfen die Schüler selbst an einem der industriellen Stanzautomaten des Projektpartners dem Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen herstellen.
Einblicke in die Welt der angewandten Physik
Für die beiden Schüler ist das Praktikum am MLZ eine spannende Erweiterung des klassischen Physikunterrichts. Beide sind im naturwissenschaftlichen Zweig ihrer Schule und haben großes Interesse an Physik. Sie erfuhren über persönliche Kontakte von der Praktikumsmöglichkeit. Von der Kernspaltung über den Reaktoraufbau bis hin zu den einzelnen Instrumenten – sie haben viel gelernt, womit sie sich zuvor nicht auseinandergesetzt hatten und zeigen auch stolz ihre selbst gravierten Schlüsselanhänger. „Es gibt hier am MLZ wirklich tausende Möglichkeiten! Ich finde handwerkliche Sachen immer ganz cool und könnte mir deshalb vorstellen, im Neutronenleiterbau zu arbeiten“, erzählt der 15-jährige Sebastian.
Neutronenleiter: Vom Glas zur Präzision
Denn die beiden besuchen auch eine Werkstatt des FRM II, wo Neutronenleiter in präziser Handarbeit gefertigt werden. Dr. Peter Link führt sie durch die Werkstätte und erklärt ihnen den Unterschied zwischen Fensterglas und dem festeren Borosilikatglas, woraus die Neutronenleiter bestehen. Dabei dürfen sie selber erfahren, dass Glas extrem gut Druck, aber wenig Zugkraft aushält – eine wichtige Eigenschaft, die beim Bau der

Tobias erklärt den beiden Schülern das Experiment an der Zugprüfmaschine auf anschauliche und verständliche Weise. © Elena Huber, FRM II/ TUM
Neutronenleiter berücksichtigt wird. Marvin hat gut aufgepasst und weiß, warum Neutronenleiter leicht gekrümmt werden: „Damit am Zielort nur kalte, energiearme Neutronen gebündelt ankommen.“ Die Krümmung sorgt dafür, dass niederenergetische Neutronen durch Totalreflexion im Leiter bleiben, während hochenergetische Neutronen und Gamma-Strahlung ins Glas entweichen.
Die Glasplatten werden dünn mit mehreren Schichten Nickel und Titan überzogen (1nm – 1µm dick) – die Dicke wird präzise mit Röntgenstrahlung gemessen. Die Schüler staunen: Die Fertigung eines 2-Meter-Neutronenleiters dauert zwei Wochen und kostet über 25.000 Euro – und das ist nur ein Bruchteil der teils hunderte Meter langen Systeme.
Der krönende Abschluss
„Tobi hat spannende Dinge für uns vorbereitet, gut erklärt und war echt lustig. Wenn er dachte, wir haben etwas nicht verstanden, hat er es nochmal anders versucht“, lautet das Fazit der beiden.
„Tobi hat auch noch eine Überraschung für uns. Er meinte, es geht um Eis und hat gefragt, ob wir eine Erdnussallergie haben“, rätselt Marvin. Wer Tobias ein bisschen kennen, ahnt bestimmt, was er vorhat. Da können sich die Jungs auf jeden Fall auf eine spannende und leckere Überraschung freuen!
Weitere News
-
27.05.2024
Industriekooperation für effizientere Elektroautos
Die Wissenschaft sieht sich oft in der Kritik, abstrakte Grundlagenforschung zu betreiben. Wie Neutronenforschung Motoren für Elektroautos verbessert, zeigt ein Projekt, das im Frühling 2024 zwischen Forschenden des FRM II, der TUM und der RWTH Aachen in Zusammenarbeit mit dem Automobilzulieferer Mubea startet. Mehr -
02.04.2020
Prägen statt Stanzen: Wie Elektromotoren noch effizienter laufen können
Eine Million E-Autos sollen bald auf Deutschlands Straßen rollen. Zwar ist der Wirkungsgrad eines Elektromotors mehr als doppelt so hoch wie beim Verbrennungsmotor. Eine noch höhere Effizienz könnte bei der Zahl an Fahrzeugen aber viel Energie einsparen. Mit einer neuen Messtechnik helfen Neutronen dabei, die Motoren noch effizienter zu machen. Mehr

Elena Huber
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit FRM II
MLZ ist eine Kooperation aus:
 > Technische Universität München
> Technische Universität München > Helmholtz-Zentrum Hereon
> Helmholtz-Zentrum Hereon
 > Forschungszentrum Jülich
> Forschungszentrum Jülich
MLZ ist Mitglied in:
 > LENS
> LENS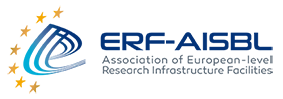 > ERF-AISBL
> ERF-AISBL
MLZ in den sozialen Medien:





